alle beiträge zu:
presse
-

bauwelt 42/1969
als pdf lesen
-

Stern 1970
als pdf lesen
-

ZEIT magazin 51/1981
Lernen mit dem ganzen Körper ZEIT magazin nr. 51/1981 11.12.1981Ein Bericht von Katharina Zimmer
-

Manfred Sack, Unwirtliche Gemütlichkeit, Die Zeit, okt1985
Die Stadt verliert ihr Elixier: das Städtische – nun erst recht Die Zeit, 11.Oktober 1985 Unwirtliche Gemütlichkeit Der „gemordeten Stadt“ zweiter Teil- mit Bildern, Dokumenten und fünf Essays / Von Manfred Sack Zwanzig Jahre…
-
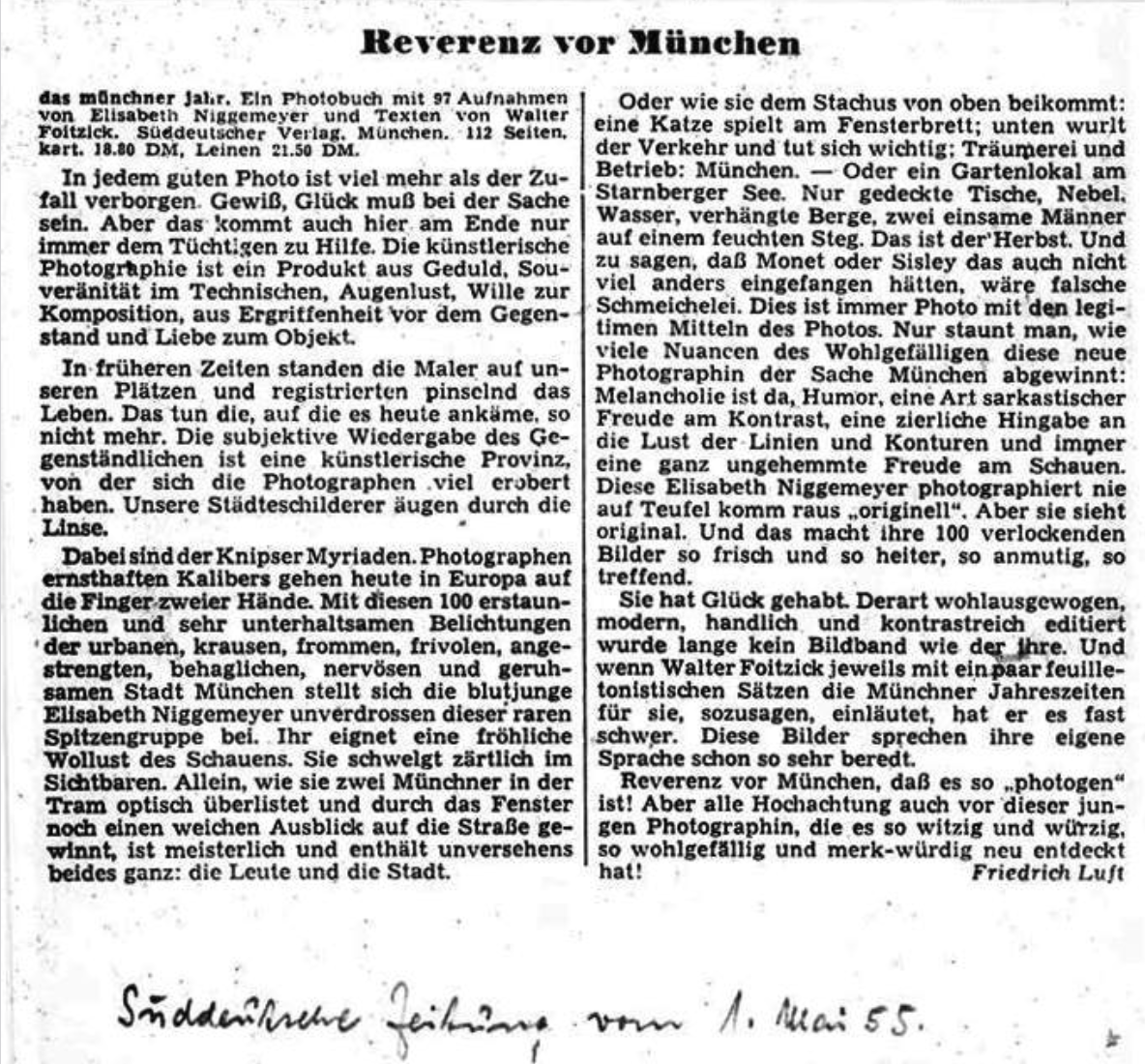
Friedrich Luft, SZ, 1955
… Reverenz vor München, daß es so „photogen“ ist! Aber alle Hochachtung auch vor dieser jungen Photographin, die es so witzig und würzig, so wohlgefällig und merk-würdig neu entdeckt hat!
-

Lernen, bevor man zur Schule geht
Tages Anzeiger Magazin, Nr.20, 20.7.1970, Jürgen Zimmer
-

Zum fünfzigjährigen Erscheinen eines Klassikers der Städtebau-Literatur
Steffen de Rudder,“Die gemordete Stadt” Zum fünfzigjährigen Erscheinen eines Klassikers der Städtebau-LiteraturForum Stadt 2 /2014 / Forum Stadt Verlag lesen ? klicken !
-

presse: ich und die welt
-

Der Spiegel 37/1977
Gefällt dir diese Familie? Für Kinder von neun Jahren an ist ein »Photo-Lesebuch« mit Berichten über Normalfamilien, über Wochenend- und Schüler-Ehen, über mutter- und elternlose Haushalte bestimmt. DER SPIEGEL 37/1977 als pdf lesen Ulrike…
-

DER SPIEGEL 12/1964
Wolf Jobst Siedler / Elisabeth Niggemeyer: »Die gemordete Stadt«. 17.03.1964, 13.00 Uhr• aus DER SPIEGEL 12/1964 Texter und Photographin verklären am Beispiel von Berlin den Charme von Großstadt-Hinterhöfen und Gründerzeit-Fassaden und verspotten die tristen…
-

Die Zerschmückung der Städte
Die Zerschmückung der Städte * 01.12.1985, 13.00 Uhr • aus DER SPIEGEL 49/1985 Sie kosten Milliarden und ärgern Millionen, die häßlichen Poller aus Beton oder Stahl. Poller – als stabile Pfähle zur Befestigung von…
-

presse: verordnete gemütlichkeit
Unwirtliche Gemütlichkeit, Der gemordeten Stadt zweiter Teil, Manfred Sack, Scheußliche neue Schönheit, Lore Ditzen, Zitty, Dieter Hoffmann-Axthelm, SFB, Die kleinen Ungeheuer, Süddeutsche Zeitung … . . . . Süddeutsche Zeitung Nr.194, 24.8.1985, Lore Ditzen,…